Het bouwrecht en de verjaring / Bauvertrag und Verjährung
Onze advocaat-partner Daan Timmerman schreef samen met advocaat Kristin Schenkel over verjaring en verval in grensoverstijgende bouwzaken. Daan beschrijft in het artikel het Nederlandse recht in het Duits, Kristin beschrijft het Duitse recht in het Nederlands. Samen bieden zij een helder overzicht van de opvallende verschillen tussen beide landen.
Het artikel is gepubliceerd in het jubileumboek ter gelegenheid van 25 jaar Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV).
Lees het artikel hieronder.

A. Inleiding/Einleitung
NL: De verjaring van vorderingen, hoe simpel in theorie, zo lastig in de praktijk. Een valkuil voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in het bouwrecht, maar zeker af en toe ook voor advocaten. In het bijzonder bij grensoverschrijdende zaken, waarbij niet altijd onmiddellijk duidelijk is welk materieel recht van toepassing is. Des te meer aanleiding voor Daan Timmerman [1] en Kristin Schenkel [2] de krachten te bundelen en een tweetalig grensoverschrijdend vergelijk van de belangrijkste verjarings- en vervalregels in het Nederlandse en Duitse bouwrecht te schrijven. Dit past uiteraard bij dit blad en bij het jubileum van de Duits Nederlandse advocatenvereniging met haar unieke grensoverschrijdende netwerk.
DE: Die Verjährung baurechtlicher Forderungen stellt sich in der Theorie leichter dar als in der Praxis. Viele Auftraggeber und Auftragnehmer stoßen regelmäßig auf diese juristischen Fallen. Gleiches gilt jedoch auch für Anwälte, insbesondere in grenzüberschreitenden Sachverhalten, bei denen nicht von Anfang an deutlich ist, welches materielle Recht zur Anwendung kommt. Grund genug für Daan Timmerman [1] und Kristin Schenkel [2] gemeinsam einen zweisprachigen Artikel und grenzüberschreitenden Vergleich der wichtigsten Verjährungsregeln im deutschen und niederländischen Baurecht zu schreiben. Dies zum Anlass des Jubiläums der deutsch-niederländischen Anwaltsvereinigung, deren grenzüberschreitendes Netzwerk einzigartig ist.
B. Het Duitse recht
I. Algemene regels omtrent verjaring in het Duitse Burgerlijke Wetboek (“Bürgerliches Gesetzbuch”/ BGB)
De algemene verjaringsregels van het Duitse civiele recht bevinden zich in het algemene gedeelte van het BGB in §§ 194 BGB e.v.. Deze regels zijn van toepassing als in de andere delen van het BGB geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Zelfs indien de VOB/B (waarover hierna meer) van toepassing wordt verklaard, wordt nog steeds, bij gebrek aan concretere regelingen, teruggevallen op dit hoofdstuk in het BGB.
De algemene termijn voor de verjaring (“Verjährung”) bedraagt drie jaar (§ 195 BGB), waarbij de manier van berekening bij niet-juristen en ook buitenlandse collega´s vaak tot verbijstering leidt. Het begin van de verjaring (volgens deze algemene regels) is namelijk niet het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, maar het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser hiervan kennis heeft verkregen of had moeten verkrijgen (§ 199 lid 1 BGB). Stel een aannemer stuurt een factuur in mei 2022 en een in augustus 2022, dan begint voor beide vorderingen de verjaringstermijn na 31 december 2022, zodat op 1 januari 2026 sprake is van verjaring. Drie jaar zijn in het Duitse verjaringsrecht meestal dus niet drie jaar, maar drie jaar plus X. Duitse advocaten zijn derhalve in december van ieder jaar druk bezig alle bestaande dossiers door te gaan om vast te stellen of er wellicht nog een te stuiten vordering in schuilt, voordat het hiervoor te laat is.
De partijen kunnen contractueel hiervan afwijkende verjaringstermijnen afspreken. Wat precies is toegestaan, beoordeelt de rechtsspraak. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken of sprake is van een afwijking in algemene voorwaarden dan wel of een individuele afspraak tussen de partijen is gemaakt. Hieronder wordt alleen op de contractuele afwijking op grond van de VOB/B ingegaan, andere contractuele afspraken blijven buiten beschouwing.
II. Bijzondere regelingen in het bouw- en architectenrecht
Door de gelaagde structuur van het BGB moet er per contractvorm rekening worden gehouden met van de algemene regels afwijkende bijzondere regelingen. Er moet per vordering worden gekeken wat de verjaringstermijn is.
a. § 631 BGB e.v. – “Werkvertragsrecht” – recht van aanneming van werk
Op 1 januari 2018 trad het nieuwe Duitse bouwrecht – een grootschalige herziening van het tot dan geldige bouwrecht in het BGB – in werking [3]. Naast het opnemen van een definitie van bouwcontracten en een eigen sectie omtrent aannemingsovereenkomsten met consumenten, werd ook veel in de praktijk toegepaste jurisprudentie gecodificeerd in nieuwe wettelijke regelingen.
Omtrent de verjaringstermijn van gebreken kent § 634a BGB een belangrijke uitzondering op de algemene regeling. Hier wordt in § 634a lid 1 Nr. 2 BGB bepaald, dat de verjaring van aanspraken op herstel van gebreken in een bouwwerk altijd vijf jaar bedragen. Hierbij speelt geen rol wat concreet inhoud van de overeenkomst was. Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden, het plannen of het bewaken van de werkzaamheden, in alle gevallen geldt de termijn conform § 634a lid 1 Nr. 2 BGB. Overigens begint deze termijn te lopen met de oplevering (§ 634 lid 2 BGB).
Hier valt al op welk grote gevaar het Duitse bouwrecht voor een aannemer herbergt. De vordering tot vergoeding van het zogeheten “Werklohn” (dit is een verzamelbegrip voor elke vorm van vergoeding waarop een aannemer aanspraak kan maken) valt niet onder § 643a BGB, maar onder de algemene regels omtrent verjaring. In de praktijk leidt dit niet zelden tot een situatie waarin een aannemer jaren na oplevering geconfronteerd wordt met vermeende gebreken, terwijl hij betalingen van openstaande vorderingen uit hetzelfde project, die hij over het hoofd heeft gezien, vaak niet meer kan afdwingen van de klant. Dit heeft tot gevolg dat aannemers vaak nog aan de slag moeten om gebreken te verhelpen, zelf echter met onbetaalde vorderingen blijven zitten. (In enkele gevallen kan hier via een juridisch trucje een verrekening met de verjaarde vordering worden afgedwongen, dit is echter de uitzondering en niet de regel.)
b. VOB/B – bijzondere bouwrechtelijke regelingen
Vaker nog dan het BGB wordt de “Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung” (VOB/B) van toepassing verklaard in het Duitse bouwrecht. Dit betekent overigens niet, dat het BGB dan helemaal niet meer van toepassing is. De VOB/B zijn algemene voorwaarden voor de bouw, die gezamenlijk door vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn opgesteld en die bij aanbestedingen (vrijwel) altijd van toepassing worden verklaard. Ook in de private bouwsector worden deze voorwaarden regelmatig als deel van het contract opgenomen. Waar de VOB/B zelf geen regeling bevat, moet worden teruggevallen op het BGB.
Vóór de herziening van de bouwrechtelijke regelingen werd vrijwel altijd voor de VOB/B en haar praktische benadering van problemen in de bouw gekozen. Sinds de actuele jurisprudentie (vaak omtrent de regelingen in de VOB/B) werd meegewogen in de nieuwe wetgeving in het BGB, wordt in contracten ook steeds vaker alleen maar voor het BGB gekozen.
Wanneer het contractvoorstel van de opdrachtgever komt, is één aspect altijd hetzelfde gebleven. Er wordt niet gekozen voor de verjaringsregeling voor gebreken uit de VOB/B. In § 13 lid 4 VOB/B is een verjaringsregeling opgenomen, die vanuit het perspectief van de opdrachtnemer goed aansluit bij de discussiepunten, die zich voordoen in de praktijk. Zo geldt volgens § 13 lid 4 Nr. 1 VOB/B voor gebreken aan bouwwerken in beginsel een verjaringstermijn van vier jaar en bij overige werkzaamheden van twee jaar. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor brand- en vuurgevoelige onderdelen. Daarop aansluitend bepaalt § 13 lid 4 Nr. 2 VOB/B dat voor onderdelen van machines en/of elektrotechnische installaties, waarbij regelmatig onderhoud van invloed is op de functionaliteit en veilig gebruik, een verjaringstermijn van twee jaren voor gebreken wordt gehandhaafd, indien de opdrachtgever geen onderhoudscontract met de opdrachtnemer is aangegaan. Deze bepaling geldt zelfs dan als er voor andere gedeeltes van het werk andere verjaringstermijnen zijn overeengekomen. Net zoals in het BGB geldt ook in de VOB/B de (deel-) oplevering als begin voor de verjaringstermijn.
Regelmatig verwijzen opdrachtgevers derhalve in hun contractvoorstellen naar de verjaringsregeling uit het BGB. Dit heeft echter voor de opdrachtnemer niet alleen nadelen. Want het éénmalig afwijken van de VOB/B heeft tot gevolg, dat deze wordt getoetst aan de beschermingsbepalingen voor algemene voorwaarden. In Nederland vindt deze toets plaats aan de hand van de zwarte en grijze lijst, in Duitsland wordt verwezen naar de inhoudscontrole uit §§ 307-309 BGB. Hier heeft de jurisprudentie bepaald, dat een groot aantal van de bepalingen uit de VOB/B niet standhouden. De opdrachtnemer kan zijn opdrachtgever, van wie het contractvoorstel met een afwijkende verjaringsregeling afkomstig is, de betreffende beoordeling desgewenst voorhouden, zonder hiervan zelf nadeel te ondervinden.
Een bijzondere verwijzing dient nog te worden gemaakt naar § 16 VOB/B. Hier worden aanvullende regelingen voor mogelijke vorderingen omtrent meerwerk achteraf geregeld. In het bijzonder § 16 lid 3 VOB/B moet door beide partijen van een aannemingsovereenkomst in acht worden genomen. Zo verliest de opdrachtnemer de mogelijkheid vorderingen omtrent meerwerk achteraf af te dwingen (Nr. 4) indien deze geen deel uitmaken van de eindafrekening (“Schlussrechnung”). Ook mag geen aanvullende factuur meer worden opgesteld zodra opdrachtgever duidelijk te kennen geeft een eindbetaling te doen en opdrachtnemer neemt deze zonder voorbehoud van rechten en weren aan.
c. Verjaring in overeenkomsten met ingenieurs en architecten
Vóór de grote herziening van het Duitse burgerlijke wetboek bestond er in de praktijk een grote kloof tussen de verjaringstermijnen van aannemers en die van ingenieurs en architecten [4]. Dit kwam door de regelingen in de zogenaamde Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (kort: HOAI). De HOAI bevat anders dan de VOB/B geen van het BGB afwijkende (materiële) regelingen voor overeenkomsten met architecten en ingenieurs, maar zoals het woord “Honorarordnung” al zegt, regelingen omtrent de vergoedingen van architecten en ingenieurs. De HOAI is de afgelopen jaren steeds meer in opspraak geraakt, gezien de Europese Commissie meerdere keren het standpunt innam dat deze in strijd was met het Europese recht, wat uiteindelijk leidde tot een de uitspraak van het EHvJ van 4 juli 2019 (C-377/17) en een herziening van de HOAI door de Duitse wetgever, die op 01-01-2021 in werking trad [5].
De HOAI clustert de door architecten en ingenieurs regelmatig uit te voeren werkzaamheden in fases (zogenaamde “Leistungsphasen”). Bij opdrachtverstrekking van alle negen fases, moest de architect en/of ingenieur nazorg en begeleiding verzorgen gedurende de garantieperiode (“Gewährleistungsfrist”) van de betrokken aannemers. Pas na afloop van deze termijnen, had de architect cq. ingenieur aan zijn verplichtingen voldaan en begon vaak pas de garantieperiode voor zijn eigen werkzaamheden. Dit veranderde met de in §§ 650 p e.v. BGB toegevoegde regelingen over de architecten- en ingenieurscontracten.
In § 650 s BGB wordt nu uitdrukkelijk geregeld, dat architecten en ingenieurs deelopleveringen van hun prestatie mogen eisen zodra de laatste werkzaamheden van de uitvoerende aannemer zijn afgerond of de uitvoerende aannemer deeloplevering eist van een door hem uitgevoerde taak. Hierdoor ontstaat meer parallelliteit van de verjaringstermijnen van de uitvoerende aannemer en de architect, die wellicht het ontwerp heeft gemaakt en die toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Dit geldt des te meer gezien er ook bij architecten als verjaringstermijn voor gebreken § 643a BGB wordt aangehouden.
c. Verjaring in overeenkomsten met ingenieurs en architecten
Vóór de grote herziening van het Duitse burgerlijke wetboek bestond er in de praktijk een grote kloof tussen de verjaringstermijnen van aannemers en die van ingenieurs en architecten [6]. Dit kwam door de regelingen in de zogenaamde Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (kort: HOAI). De HOAI bevat anders dan de VOB/B geen van het BGB afwijkende (materiële) regelingen voor overeenkomsten met architecten en ingenieurs, maar zoals het woord “Honorarordnung” al zegt, regelingen omtrent de vergoedingen van architecten en ingenieurs. De HOAI is de afgelopen jaren steeds meer in opspraak geraakt, gezien de Europese Commissie meerdere keren het standpunt innam dat deze in strijd was met het Europese recht, wat uiteindelijk leidde tot een de uitspraak van het EHvJ van 4 juli 2019 (C-377/17) en een herziening van de HOAI door de Duitse wetgever, die op 01-01-2021 in werking trad [7].
De HOAI clustert de door architecten en ingenieurs regelmatig uit te voeren werkzaamheden in fases (zogenaamde “Leistungsphasen”). Bij opdrachtverstrekking van alle negen fases, moest de architect en/of ingenieur nazorg en begeleiding verzorgen gedurende de garantieperiode (“Gewährleistungsfrist”) van de betrokken aannemers. Pas na afloop van deze termijnen, had de architect cq. ingenieur aan zijn verplichtingen voldaan en begon vaak pas de garantieperiode voor zijn eigen werkzaamheden. Dit veranderde met de in §§ 650 p e.v. BGB toegevoegde regelingen over de architecten- en ingenieurscontracten.
In § 650 s BGB wordt nu uitdrukkelijk geregeld, dat architecten en ingenieurs deelopleveringen van hun prestatie mogen eisen zodra de laatste werkzaamheden van de uitvoerende aannemer zijn afgerond of de uitvoerende aannemer deeloplevering eist van een door hem uitgevoerde taak. Hierdoor ontstaat meer parallelliteit van de verjaringstermijnen van de uitvoerende aannemer en de architect, die wellicht het ontwerp heeft gemaakt en die toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Dit geldt des te meer gezien er ook bij architecten als verjaringstermijn voor gebreken § 643a BGB wordt aangehouden.
III. Stuiting van de verjaring in het algemeen en in het bouwrecht
Algemene regelingen
Indien de verjaringstermijn door partijen zelf correct is vastgesteld, moet er desondanks nog worden opgelet, want het stuiten (“Verjährungshemmung”) van de verjaring in Duitsland en het overzien van de gevolgen daarvan zijn nog niet zo simpel. Dit geldt des te meer voor partijen, die het Nederlandse stelsel gewend zijn. Zowel de manier waarop stuiting kan worden bereikt als ook de gevolgen zijn anders dan in het Nederlandse recht. Allereerst betekent stuiting van de verjaring in het Duitse recht, dat de verjaringsklok op pauze wordt gezet maar geenszins wordt gereset. Als gevolg hiervan wordt de verjaring voortgezet vanaf het punt waarop de stuiting plaats vond, zodra deze stuitingshandeling is weggevallen. Per geval van stuiting moet derhalve worden gekeken voor hoe lang de verjaring wordt tegengehouden.
De vaakst voorkomende en tegelijkertijd de moeilijkst te bepalen stuiting van de verjaring is in § 203 BGB te vinden. Zijn er tussen de partijen onderhandelingen betreffend de vordering gaande – ook buitengerechtelijk en zonder advocaat – dan bepaalt § 203 eerste zin BGB dat de verjaring gestuit wordt totdat één van de partijen duidelijk maakt de onderhandelingen niet te willen voortzetten. De vordering verjaart dan niet direct daarna, maar op z´n vroegst drie maanden na het einde van de onderhandelingen. Hoewel er vrijgevig wordt omgegaan met het vraagstuk wanneer er sprake is van onderhandelingen en tot wanneer, is de berekening van de concrete verjaringstermijn in de praktijk erg lastig. Voeren de partijen over een langere periode met meerdere onderbrekingen van enkele maanden onderhandelingen, dan durft vrijwel niemand met zekerheid het einde van de verjaringsperiode te bepalen.
Derhalve kiest men (en dit geldt zeker voor Duitse advocaten) voor een stuiting conform § 204 BGB, namelijk door gebruik te maken van een procedureel middel, dat zeker en eenduidig de verjaring tot minimaal 6 maanden na beëindiging van deze procedurestuit. Dit is dan ook de reden waarom in Duitsland advocaten de stuitingshandeling uitvoeren. De allermeeste procedures en stappen die zijn voorzien in § 204 BGB kunnen de partijen zelf niet uitvoeren en zij zijn dus afhankelijk van het inschakelen van een (Duitse) advocaat.
Het schrijven van een simpele sommatie vormt volgens Duits recht namelijk geen zekere manier om een stuiting te bereiken.
2. Bouwrechtelijke bijzonderheden
In de bouwrechtelijke praktijk hoeven geen bijzondere stuitingsregeling in acht te worden genomen. Er moet wel bijzonder goed worden gelet op de stuiting van de verjaring met onderaannemers. Hier vormen allereerst de verschillende momenten van oplevering een rol, die tot gevolg kunnen hebben, dat een aannemer pas kennis krijgt van een stuitingsprocedure ten opzichte van een gebrek op een moment waarop zijn vordering tegen de betreffende onderaannemer al verjaard is. Ook moeten aannemers zich bewust zijn van het in vrijwaring oproepen, als enige (rechts)zekere optie conform § 204 BGB om zowel de stuiting van de verjaring te bereiken, als ook afwijkende uitspraken van verschillende rechtbanken omtrent hetzelfde vraagstuk.
Kortom de verjaring speelt in het Duitse bouwrecht een grote rol, het gevaar – waardevolle vorderingen – wegens verjaring af te moeten schrijven ligt hier bijzonder vaak op de loer.
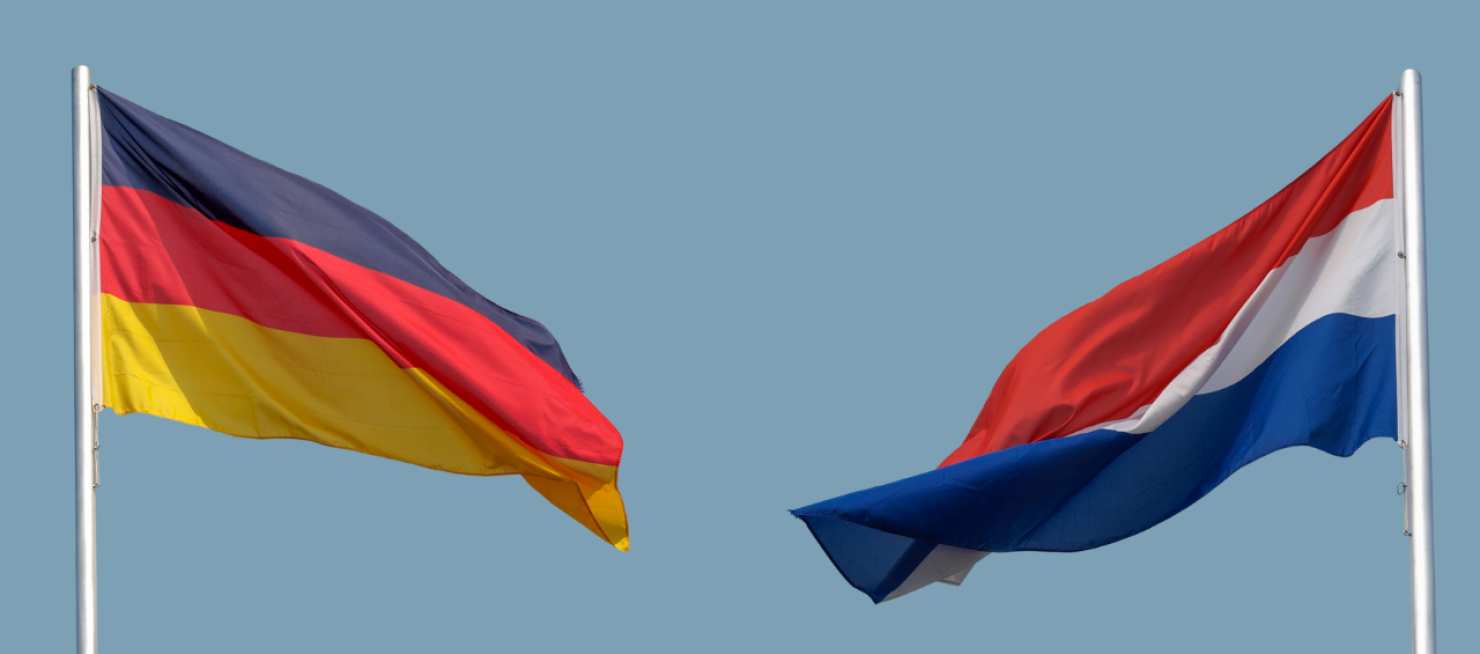
C. Verjährung im niederländischen Baurecht
I. Allgemeine Einführung
Auch im niederländischen Baurecht haben wir mit unterschiedlichen Verjährungs- und Ablauffristen zu tun. Einige davon ergeben sich aus den allgemeinen Regeln, die das niederländische Bürgerliche Gesetzbuch (BW) für Verjährung und Ablauf beschreibt, andere wurden im besonderen Teil, dem sogenannten 12. Titel des 7. Buches des BW aufgenommen, dem Titel, der speziell für den Werkvertrag geschrieben wurde und der am 1. September 2003 in Kraft getreten ist.
Im niederländischen Baurecht werden viele verschiedene, bauspezifische Bedingungen angewandt, die oft über eigene Vorschriften verfügen, die von den gesetzlichen Vorgaben abweichen. Es würde zu weit führen, all diese Regelungen hier erschöpfend zu erörtern, aber wir gehen im Folgenden auf drei häufig verwendete Bedingungskonstellationen ein. Es betrifft die Vertragsbedingungen UAV 2012, die UAV-GC 2005 für integrierte Verträge und die DNR 2011, die für Rechtsbeziehungen mit Architekten und Ingenieuren für anwendbar erklärt werden können und versicherungsbedingt auch meistens werden.
Die nachfolgende Übersicht dient der Veranschaulichung und ist keineswegs erschöpfend. Wenn Sie noch viel mehr zum Thema Verjährung im Baurecht lesen möchten, verweisen wir Sie gerne auf das Praxisbuch Verjährung und Ablauf im Baurecht“ von S.J.H. Rutten, herausgegeben vom niederländischen Institut für Baurecht, IBR (“Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw”).
II. Das Bürgerliche Gesetzbuch
Das niederländische Bürgerliche Gesetzbuch (BW) ist ebenfalls geschichtet aufgebaut: Es ist in mehrere Bücher aufgeteilt. Das 3. Buch befasst sich mit dem Sachenrecht, Buch 6 mit dem Vertragsrecht und Buch 7 mit Sondervereinbarungen.
1. Buch 3 BW
Artikel 3:306 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs schreibt vor, dass ein Rechtsanspruch nach zwanzig Jahren verjährt, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Der Artikel schreibt nicht vor, wann diese Frist zu laufen beginnt. Da dieser Artikel direkt zu Anfang, auf andere gesetzliche Bestimmungen verweist, ist es interessant zu untersuchen, welche andere dieser gesetzlichen Bestimmungen im Baurecht gelten.
Der nächste Gesetzesartikel im dritten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Artikel 3:307, befasst sich mit der Verjährung des Rechtsanspruchs auf ein Tun oder auf ein Geben, also auf eine Leistung. Dieser Anspruch verjährt fünf Jahre nach Beginn des Tages, der auf den Tag folgt, an dem der Anspruch fällig wurde.
Artikel 3:310 BW schreibt dann im ersten Absatz vor, dass ein Rechtsanspruch auf Schadensersatz oder auf Zahlung einer festgesetzten Vertragsstrafe fünf Jahre nach Beginn des Tages verjährt, der auf den Tag folgt, an dem der Geschädigte sowohl mit dem Schaden, bzw. mit der Fälligkeit der Vertragsstrafe sowie mit dem dafür Verantwortlichen bekannt geworden ist.
Der zweite Absatz dieses Artikels verlängert die Verjährungsfrist auf dreißig Jahre, im Fall von Verseuchung von Luft, Wasser oder Boden.
Artikel 3:320 BW verlängert eine Verjährungsfrist unter bestimmten Umständen noch weitergehender: Wenn eine Verjährungsfrist während des Vorliegens eines Verlängerungsgrunds oder innerhalb von sechs Monaten nach Wegfall dieses Grunds ablaufen würde, läuft die Frist nach dem Wegfall dieses Verlängerungsgrunds noch sechs Monate weiter.
2. Buch 6 BW
Für die Praxis sehr wichtig ist Artikel 6:89 BW, der vorsieht, dass sich der Gläubiger nicht auf einen Mangel in einer Leistung berufen kann, wenn er nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er diesen Mangel entdeckt hat oder hätte, entdecken müssen, den Mangel beim Schuldner angezeigt und dagegen protestiert hat. Dies ist die allgemeine Regel im Sachenrecht, die für alle Vereinbarungen gilt, auch für mangelhafte Leistungen bei der Erfüllung von Bauverträgen. Wie lange diese angemessene Frist ist, ist nicht definiert und muss vom Richter oder Schiedsrichter je nach den Umständen des Falls bestimmt werden.
3. Buch 7 BW
Im dritten Absatz des Artikel 7:758 BW steht, dass der Auftragnehmer nicht haftet für Mängel die der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Abnahme vernünftigerweise („redelijkerwijs“) hätte entdecken müssen.
Artikel 7:761 BW schreibt im ersten Absatz vor, dass jeder Rechtsanspruch wegen eines Mangels in einer Bauleistung nach der Abnahme („in het opgeleverde werk“), zwei Jahre nach entsprechender Rüge durch den Auftraggeber verjährt. Wann ein Auftraggeber eine Rüge auszusprechen hat, wird in dem Artikel nicht festgelegt (siehe auch Artikel 6:89 BW oben: innerhalb einer angemessenen Frist).
Absatz 2 bestimmt dann, dass der Rechtsanspruch in jedem Fall mit Ablauf von zwanzig Jahren nach Abnahme der Bauleistung verjährt. Absatz 3 enthält eine Regelung, die die Verjährungsfrist gemäß den Bestimmungen von Artikel 3:320 BW verlängert, wenn die Verjährung der Forderung eingetreten wäre, zwischen dem Zeitpunkt an dem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass er den Schaden untersuchen oder reparieren wird und dem Zeitpunkt an dem diese Untersuchung oder die Reparaturversuche als scheinbar beendet anzusehen sind.
Die gesetzlichen Verjährungsfristen sind grundsätzlich ordnungsrechtlicher Art, so dass hiervon vertraglich abgewichen werden kann. Wie wir weiter unten anhand einiger typischer Bedingungen sehen werden, wird diese Möglichkeit gerne genutzt.
Eine Ausnahme hiervon ist in Artikel 7:762 BW beschrieben: Wenn der Auftragnehmer versteckte Mängel verschwiegen hat, ist die Verjährungsfrist nicht kürzer als in Artikel 7:761 BW beschrieben. Von dieser Regel kann auch nicht durch vertragliche Regelungen abgewichen werden.
III. UAV 2012
Die „Einheitlichen Verwaltungsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und technischen Installationsarbeiten 2012“ (UAV 2012) sind häufig verwendete Bedingungen für Bauverträge in den Niederlanden. Diese Bedingungen können in den klassischen Bauverträgen verwendet werden, in denen der Auftraggeber mit Hilfe eines Architekten und/oder anderer Berater eine Projektplanung für das angedachte Bauprojekt erstellt, diese Planung ausarbeiten lässt und dann den Auftragnehmer beauftragt, diese gemäß der ausgearbeiteten Details zu realisieren. Der Auftragnehmer hat daher grundsätzlich keine Gestaltungsaufgabe und darf von der Richtigkeit der vom Auftraggeber gelieferten Unterlagen ausgehen. Die UAV von 2012 sind eine Aktualisierung der vorherigen UAV von 1989, die wiederum eine Aktualisierung der UAV von 1968 sind.
In der Praxis beobachten wir, dass nicht-öffentliche Auftraggeber Änderungen und Ergänzungen der UAV 2012 vornehmen, teilweise auch im Hinblick auf Verjährungsfristen und gerne zu ihrem Vorteil. Öffentlich-rechtliche Auftraggeber werden diesbezüglich durch das für sie verbindliche Vergaberecht in ihren Möglichkeiten begrenzt.
Ablauffrist in § 12 UAV 2012
§ 12 UAV 2012 beschreibt die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht mehr für Mängel nach dem Tag der Abnahme, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der (i) dem Auftragnehmer zuzurechnen ist, (ii) der darüber hinaus trotz sorgfältiger Überwachung während der Ausführung, oder zum Zeitpunkt der Abnahme nicht identifiziert werden konnte und (iii) der dem Auftragnehmer innerhalb einer angemessenen Frist nach Entdeckung mitgeteilt wurde. Es handelt sich hier also um einen versteckten Mangel.
§ 12 UAV 2012 Absatz 4 sieht vor, dass eine Klage wegen eines solchen versteckten Mangels unzulässig ist, wenn sie fünf Jahre nach dem Tag, an dem das Werk als abgenommen anzusehen ist, erhoben wird. Wenn das Werk ganz oder teilweise untergegangen ist, einzustürzen droht oder für seine Bestimmung ungeeignet geworden ist oder ungeeignet zu werden droht und dies nur durch sehr aufwendige Maßnahmen behoben oder verhindert werden kann, beträgt die Ablauffrist nicht fünf, sondern zehn Jahre.
§ 12 UAV 2012 Absatz 5 sieht vor, dass, wenn zwischen den Parteien eine Unterhaltsfrist gemäß § 11 UAV 2012 vereinbart wurde, die Ablauffrist am Tag der Kontrolle am Ende der Unterhaltsfrist beginnt. Diese sogenannte Unterhaltsfrist ist eine vertraglich festgelegte Periode, in der der Auftragnehmer jeden Mangel zu beseitigen hat, außer wenn er annehmbar machen kann, dass der Mangel nicht auf Unzulänglichkeiten in seiner Leistung zurückzuführen ist.
2. Ablauffrist in § 49 UAV 2012
§ 49 Abs. 3 UAV 2012 beschreibt die Situation, in der sich Auftragnehmer und Auftraggeber über die Abrechnung streiten. Hat der Auftraggeber schriftlich und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 49 Abs. 3 UAV 2012 dem Auftragnehmer seine endgültige Entscheidung über die Schlussabrechnung mitgeteilt, so ist eine Forderung des Auftragnehmers unzulässig, wenn er mehr als sechs Monate nach dieser schriftlichen Mitteilung Ansprüche geltend macht die anders sind als in der endgültigen Entscheidung des Auftraggebers steht.
IV. UAV-GC 2005
Als „neue“ Vertragsform wurden die Einheitlichen Verwaltungsbedingungen für integrierte Verträge (UAV-GC) entwickelt, bei denen der Auftragnehmer neben ausführenden Aufgaben auch Entwurfsaufgaben hat. Diese Vertragsart entstand in den Niederlanden Ende der 1990er Jahre im Bereich des Wasser- und Straßenbaus. In den Jahren 2000 bis 2004 wurden Versuche mit dem Vorgänger der aktuellen Bedingungen, den UAV-GC 2000, durchgeführt. Die Erfahrungen mit diesen Bedingungen sind in die aktuellen UAV-GC 2005 eingeflossen.
In der Praxis verlangt die Anwendung dieser Bedingungen vom Auftraggeber, sehr genau zu formulieren, was er genau will, und sich Gedanken über den Gestaltungsprozess des Auftragnehmers zu machen: An welchen Entscheidungen will er beteiligt sein? Wie wird sichergestellt, dass das, was der Auftragnehmer entwirft, auch wirklich dem entspricht, was der Auftraggeber will? Das führt oft zu Streitigkeiten während der Bauphase und im Nachhinein.
1. Ablauffrist in § 28 Abs. 2 UAV-GC 2005
§ 28 UAV-GC 2005 regelt die Haftung des Auftragnehmers nach der Abnahme und Übergabe. Der Wortlaut dieses Absatzes ist dem von Absatz 12 UAV 2012 sehr ähnlich.
Der Auftragnehmer haftet nur für Mängel, die (i) auf das Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind oder die aufgrund von Gesetzen, Rechtsakten oder allgemein anerkannten Auffassungen zu seinen Lasten gehen und die außerdem (ii) vom Auftraggeber vor der Übergabe nicht bemerkt wurden und die darüber hinaus (iii) der Kunde zum Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung vernünftigerweise nicht hätte entdecken müssen.
Klagen wegen eines solchen versteckten Mangels sind nicht zulässig, wenn sie nach Ablauf von fünf Jahren nach der tatsächlichen Übergabe erhoben werden, es sei denn sie werden innerhalb von 10 Jahren nach diesem Tag erhoben, wenn das Werk ganz oder teilweise einzustürzen oder untauglich zu werden droht, was nur durch außergewöhnliche und sehr kostspielige Maßnahmen verhindert werden kann.
2. Ablauffrist in § 32 UAV-GC 2005
Eine mögliche Erweiterung des Auftrags des Auftragnehmers im Rahmen der UAV-GC 2005 ist die mehrjährige Instandhaltungsverpflichtung der abgeschlossenen Arbeiten. Dies wird in § 29 ff. der UAV-GC 2005 beschrieben. Schließlich ist es einer der Grundgedanken hinter den integrierten Verträgen, einen Anreiz einzubauen, der dazu führt, dass der Auftragnehmer über die Qualität der zu verwendenden Materialien nachdenkt, gerade wenn diese Qualität nicht vom Auftraggeber ausdrücklich vorgeschrieben wird. Indem er nicht nur für das Design und die Ausführung verantwortlich ist, sondern auch für die mehrjährige Instandhaltung der abgeschlossenen Arbeiten, wird der Auftragnehmer stimuliert, darüber nachzudenken, wie er diese Instandhaltung so effizient wie eben möglich durchführen kann. Wenn nichts beschädigt wird, hat er weniger Instandhaltungskosten. Bei einem Fixpreis ist das für den Auftragnehmer günstig.
§ 32 UAV-GC 2005 regelt die Haftung für Mängel der mehrjährigen Instandhaltung, die nach Ablauf der mehrjährigen Instandhaltungsfrist auftreten.
Der Wortlaut von § 32-1, der Beschreibung der Art der Nichteinhaltung, für die der Auftragnehmer nach Ablauf der mehrjährigen Instandhaltungsfrist verantwortlich ist, ist fast wörtlich identisch mit dem oben zitierten § 28 UAV-GC 2005.
§ 32-2 UAV-GC 2005 sieht sodann vor, dass Klagen wegen eines solchen Mangels unzulässig sind, wenn sie ein Jahr nach Ablauf der mehrjährigen Instandhaltungsfrist erhoben werden.
3. Ablauffrist in § 47-3 UAV-GC 2005
Auch bei integrierten Verträgen wird eine Regelung aufgenommen, für den Fall, dass zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Meinungsverschiedenheit über die Abrechnung entsteht. Wir haben diese Regelung bereits bei den UAV 2012 besprochen, genauer gesagt die Regelung aus § 49 Abs. 3 UAV 2012. Die Unterschiede zu der Regelung in § 47-3 UAV-GC 2005 sind nicht materiell, sondern lediglich redaktioneller Natur. Notwendig sind die Änderungen vor allem durch die abweichende Bezeichnung der Beteiligten. Anders als in den UAV 2012 handelt es sich bei den UAV-GC 2005 nicht um einen Bauunternehmer, sondern um einen Auftragnehmer, da sein Auftrag in diesem Fall auch mehr als nur die Errichtung eins Werkes umfasst. Es können – wie bereits besprochen – nämlich auch Design und mehrjährige Instandhaltung zu seinen Aufgaben gehören.
V. Architekten und Ingenieure
1. DNR 2011
Die DNR 2011 beinhaltet eine Reihe von Bedingungen, die speziell für Berater im Bauprozess verfasst wurden, insbesondere für Architekten und beratende Ingenieure. Vor der Einführung des DNR hatten die verschiedenen Branchen ihre eigenen Bedingungen: Die beratenden Ingenieure erklärten ihre RVOI 2001 für anwendbar und die Architekten ihre SR 1997. Im Jahr 2005 wurden diese Bedingungen zusammengefügt und harmonisiert unter der Überschrift De Nieuwe Regeling 2005 (wörtlich übersetzt: Die Neue Regelung 2005). Die Neue Regelung wurde 2011 aktualisiert.
3. Haftungsdauer und Ablauffristen in Artikel 16 DNR 2011
Artikel 16 Abs. 1 DNR 2011 bestimmt, dass die Haftung des Beraters fünf Jahre nach dem Tag erlischt, an dem der Auftrag durch Vollendung oder Kündigung beendet wurde.
Der Rechtsanspruch wegen eines zurechenbaren Mangels entfällt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder vernünftigerweise hätte, entdecken müssen, diesen schriftlich gegenüber dem Berater anzeigt (Artikel 16 Absatz 2 DNR 2011). Die DNR 2011 beschreibt nicht, wie lange diese angemessene Frist ist. Das bleibt der Rechtsprechung überlassen.
Artikel 16 Absatz 3 kennt eine weitere Ablauffrist: Der Kunde muss innerhalb von zwei Jahren nach Einreichung einer schriftlich begründeten Rüge (siehe Absatz 2 oben) einen Rechtsanspruch geltend machen, anderenfalls ist sein Anspruch nicht mehr zulässig.
Der vierte Absatz besagt, dass der Rechtsanspruch wegen eines zurechenbaren Mangels in jedem Fall nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Tag verjährt ist, an dem der Auftrag durch Vollendung oder Kündigung beendet wurde.
Noch gefährlicher wird es, wenn der Berater seine Schlussrechnung früher übersendet als an dem Tag, an dem der Auftrag durch Vollendung oder Kündigung endet. Legt er früher seine Rechnung, so gilt bereits das Datum der Schlussrechnung als der Tag, an dem der Auftrag endete (Art. 16 Abs. 5 DNR 2011). Dadurch beginnt und endet die Ablauffrist sodann auch früher.
Der achte und letzte Absatz von Artikel 16 bietet dem Kunden dennoch unter bestimmten Umständen eine Verlängerung der Ablauffrist: Wenn der Rechtsanspruch nach den Bestimmungen des Artikels 16 verjährt wäre, zwischen dem Zeitpunkt an dem der Berater den Kunden darüber informiert hat, dass er den Mangel entweder untersuchen oder beseitigen lässt und dem Zeitpunkt an dem er die Untersuchung und die Nachbesserungsversuche offenbar als beendet ansieht, verlängert sich die Verjährungsfrist um weitere sechs Monate nach diesem (zuletzt erwähnten) Zeitpunkt.
VI. Hemmung der Verjährung
Abschließend noch ein Wort zur Hemmung der Verjährung. Artikel 3:316 BW sieht vor, dass die Verjährung eines Rechtsanspruchs durch die Erhebung eines Anspruchs und durch jede andere Form der Rechtsverfolgung durch den Berechtigten, die ordnungsgemäß durchgeführt wird, gehemmt wird.
Artikel 3:317 Absatz 1 BW bestimmt anschließend, dass die Verjährungsfrist für einen Rechtsanspruch auf Erfüllung einer Verbindlichkeit durch eine schriftliche Mahnung oder durch eine schriftliche Mitteilung gehemmt wird, in der sich der Gläubiger sein Recht auf Erfüllung eindeutig vorbehält. Den Zugang dieser Mitteilung hat der Gläubiger zu beweisen.
Der zweite Absatz sieht ferner vor, dass die Verjährungsfrist für andere gesetzliche Ansprüche durch eine schriftliche Mahnung gehemmt wird, wenn darauf innerhalb von sechs Monaten eine Hemmungshandlung im Sinne von Artikel 3:316 BW folgt.
Schließlich sieht Artikel 3:319 BW kurz zusammengefasst vor, dass durch die Hemmung der Verjährungsfrist eines Rechtsanspruchs, anders als durch die Einreichung eines klageweise geltend gemachten Anspruchs mit anschließendem Urteil, eine neue Verjährungsfrist zu laufen beginnt, und zwar am jeweils nächsten Tag nach dieser (ersten) Hemmung. Die Länge der neuen Verjährungsfrist entspricht der der ursprünglichen Frist. Sie ist jedoch nicht länger als fünf Jahre. Die Verjährung tritt jedoch in keinem Fall früher ein als zu dem Zeitpunkt, an dem die ursprüngliche Verjährungsfrist ohne Hemmung abgelaufen wäre.

D. Tot slot/ Schlusswort
NL: Samenvattend zien wij, dat een groot aantal regelingen in het bouw- en architectenrecht in Nederland en Duitsland weliswaar op elkaar lijken, maar in detail erg verschillend zijn met een aantal “nare” valstrikken. Wettelijk zijn er veel verjaringstermijnen te vinden, in de verschillende bouwrechtelijke voorwaarden zijn ook veel vervaltermijnen opgenomen, die niet kunnen worden gestuit. Grensoverschrijdend werkzame partijen moeten deze regelingen goed kennen, zodat ze niet per ongeluk in een verjaringsval lopen.
DE: Abschließend können wir festhalten, dass die Vorschriften im Bau- und Architektenrecht in den Niederlanden und Deutschland zwar ähnlich, aber im Detail unterschiedlich sind, mit einer Reihe „gemeiner“ Fallstricke. Gesetzlich finden wir überwiegend Verjährungsfristen, in den unterschiedlichen Baubedingungen jedoch häufiger Ablauffristen vor, die sich nicht hemmen lassen. Grenzüberschreitend tätige Parteien müssen sich diese Regeln gut vor Augen führen, so dass sie nicht in eine Verjährungsfalle „tappen“.
Voetnoten/ Fußnoten
[1]
Mr. Daan Timmerman is specialist voor bouwrecht bij Brackmann in Rotterdam. Hij spreekt vloeiend Duits en Nederlands en begeleidt Duitse cliënten in Nederland.
Mr. Daan Timmerman ist Baurechtsspezialist bei Brackmann in Rotterdam. Er ist vollständig zweisprachig und berät Deutsche Mandanten in den Niederlanden.
[2]
Mr. Kristin Schenkel heeft Duits en Nederlands recht gestudeerd. Als Duitse advocaat bij Heisterborg International adviseert zij Nederlandse cliënten bij bouw- en vastgoedprojecten in Duitsland.
Mr. Kristin Schenkel hat deutsches und niederländisches Recht studiert, Als Rechtsanwältin bei Heisterborg International berät sie niederländische Mandanten bei Bau- und Immobilienprojekten in Deutschland.
[3]
Een mooie uiteenzetting met twee delen is te vinden van RiBGH Harald Reiter in JA 2018,161: Das neue Bauvertragsrecht – Teil I: Allgemeines Werkvertragsrecht und Bauvertrag.
[4]
Deel twee van de beschouwing van RiBGH Harald Reiter behandelt overeenkomsten met architecten en ingenieurs in JA 2018,241: Das neue Bauvertragsrecht – Teil II: Verbraucherbauvertrag, Architekten- und Ingenieurvertrag, Bauträgervertrag.
[5]
Nadere informatie en een overzicht over de doorgevoerde wijzigingen: HOAI 2021: Verbindlich unverbindlich? - Überblick über die Änderungen der neuen HOAI und des Ermächtigungsgesetze, Orlowski in ZfBR 2021,315.
[6]
Deel twee van de beschouwing van RiBGH Harald Reiter behandelt overeenkomsten met architecten en ingenieurs in JA 2018,241: Das neue Bauvertragsrecht – Teil II: Verbraucherbauvertrag, Architekten- und Ingenieurvertrag, Bauträgervertrag.
[7]
Nadere informatie en een overzicht over de doorgevoerde wijzigingen: HOAI 2021: Verbindlich unverbindlich? - Überblick über die Änderungen der neuen HOAI und des Ermächtigungsgesetze, Orlowski in ZfBR 2021,315.